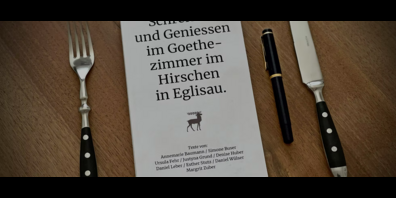Religion und Krankheitsverständnis
Eine 70-jährige Patientin betritt meine Praxis. Sie kommt selten zum Arzt, doch diesmal beunruhigen sie verschiedene Symptome. Die Blutuntersuchung zeigt eine ausgeprägte Blutarmut – ein Befund, der dringend weitere Untersuchungen erfordert. Doch die Patientin lehnt ab. Ihr Leben liege in Gottes Hand, sagt sie. Sie akzeptiere Krankheit und auch den Tod als göttlichen Willen.
Religion spielt für viele Patienten eine entscheidende Rolle. Sie suchen Heilung nicht nur in der Medizin, sondern auch im Glauben. Manche hoffen auf ein Wunder, andere finden Trost in der Überzeugung, dass ihr Leiden einen höheren Sinn hat. Für uns Ärzte bedeutet das, eine Balance zwischen medizinischer Notwendigkeit und religiöser Überzeugung zu finden.
Als Arzt begegne ich Menschen unterschiedlichster Kulturen und Glaubensrichtungen. Christen, Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten – alle bringen ihre eigene Sicht auf Krankheit und Heilung mit. Für manche ist jede medizinische Massnahme ein Eingriff in Gottes Schöpfung, während andere moderne Therapien ohne Schwierigkeiten in Anspruch nehmen. Gerade in kritischen Situationen kann dies zu Konflikten führen: Wie überzeugt man eine gläubige Patientin, dass eine notwendige Behandlung kein Widerspruch zu ihrem Glauben ist?
Wissenschaft und Glaube werden oft als Gegensätze betrachtet. Doch das ist ein Trugschluss. Religionen haben sich nie grundsätzlich gegen die Medizin gestellt. Viele religiöse Führer fordern Gläubige sogar auf, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die moderne Medizin ist das Ergebnis jahrhundertelanger Forschung, die sich gerade mit den Unzulänglichkeiten des menschlichen Körpers befasst. Sie ist ein Werkzeug, kein Widerspruch zum Glauben.
Die Wissenschaft strebt nach objektiver Wahrheit, nach überprüfbaren Fakten. Die Naturgesetze sind unser Massstab, klinische Studien unser Werkzeug. Doch so sehr wir verstehen, wie Krankheiten entstehen und wie wir sie behandeln können, auf die Frage nach dem „Warum“ kann die Medizin keine Antwort geben. Warum trifft es mich und nicht den anderen? Warum muss ich leiden? An dieser Stelle beginnt der Bereich des Glaubens.
Religion gibt vielen Menschen Halt und Hoffnung. Sie bietet ein Narrativ, das über die rationale Erklärung hinausgeht. Rituale, Gebete und Meditationen können Trost spenden, Ängste lindern und sogar den Heilungsprozess positiv beeinflussen. Studien zeigen, dass gläubige Menschen oft eine höhere Resilienz gegenüber schweren Erkrankungen haben. Ihre innere Überzeugung, eingebettet in eine Gemeinschaft, gibt ihnen Kraft.
Unsere Aufgabe als Ärzte ist es, nicht nur Körper, sondern auch Seelen zu heilen – und dabei die religiösen Überzeugungen unserer Patienten zu respektieren. Es geht nicht darum, den Glauben infrage zu stellen, sondern Brücken zu bauen. Wenn eine Patientin die moderne Medizin ablehnt, hilft es nicht, mit Argumenten zu konfrontieren, die ihren Überzeugungen widersprechen. Vielmehr gilt es, Wege zu finden, die sowohl medizinisch sinnvoll als auch mit ihrem Glauben vereinbar sind.
Die Medizin kann nicht alles erklären – aber sie kann helfen. Und sie kann den Dialog mit dem Glauben suchen, anstatt ihn auszuschliessen. Für Ärzte bedeutet dies, dass sie sich mit den religiösen Überzeugungen ihrer Patienten auseinandersetzen sollten. Krankheiten rufen existentielle Fragen hervor, die oft nicht nur mit medizinischen, sondern auch mit spirituellen Mitteln beantwortet werden. Eine sensible und respektvolle Kommunikation kann helfen, medizinische Behandlung und religiöse Überzeugungen in Einklang zu bringen.
Dr. med. Giovanni Fantacci, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin mit Hausarztpraxis in Niederhasli.