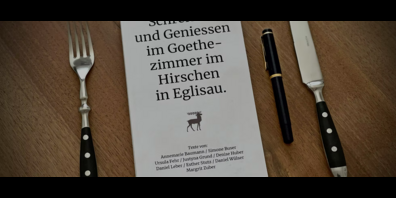In einer Zeit, als Embrach weniger als 2000 Einwohner zählte, existierten über zehn Wirtschaften gleichzeitig – ein erstaunliches Phänomen, das Hans Baer in seiner neuen Broschüre genau unter die Lupe nimmt. „Es waren praktisch alles nur Nebenerwerbszweige“, erklärt er. Neben ihrer Tätigkeit als Gastwirte arbeiteten viele Betreiber als Müller, Metzger, Bäcker oder Weinbauern.
Auch die gesellschaftliche Bedeutung der Wirtschaften kommt zur Sprache. Während die Taverne eine Anlaufstelle für Reisende war, dienten die meisten anderen Lokale als Trinkstätten für Einheimische. Erst mit der Eröffnung der Bahnlinie der Nordostbahn im Jahr 1876 entwickelten sich Speisewirtschaften.
Recherche mit Hindernissen
Baers Arbeit an der Broschüre begann bereits vor Jahren. Doch die ständigen Besitzerwechsel vieler neuerer Wirtschaften erschwerten die Recherche. „Die Betreiber hatten oft keinen Bezug zum Gebäude und wussten wenig über dessen Geschichte“, erzählt er. Daher entschied er sich, nur die traditionsreichen Gaststätten zu behandeln.
Für die Bebilderung griff der Historiker auf sein eigenes umfangreiches Archiv, das Internet sowie das Staatsarchiv Zürich zurück. Besonders spannend fand er die Geschichte der Obermühle mit ihrer legendären Wirtin Lisette, die ihre Preise stets in Rappen angab, oder die des Neugut, dessen Wirt ein Embracher Lehrer war.
zu24: Herr Baer, was hat Sie dazu inspiriert, die Geschichte der Embracher Wirtschaften zu erforschen und in einer Broschüre festzuhalten?
Hans Baer: Das war ein Projekt, das ich schon vor etlichen Jahren begonnen hatte. Die Schwierigkeit war, dass bei vielen neuen (= nach 1950) Wirtschaften ständige Wechsel in kurzer Zeit zu verzeichnen waren. Ausserdem waren die Besitzer nicht mehr die Betreiber, sondern Immobiliengesellschaften, die die Lokale bloss vermieteten. Die Betreiber hatten darum eigentlich keinen Bezug zum Gebäude und wussten auch viel zu wenig. Darum entschloss ich mich bei der Fertigstellung nur noch die althergebrachten Lokale zu behandeln, was immer auch "althergebracht" heissen mag.
zu24: Ihre neue Publikation beleuchtet die Entwicklung der lokalen Gasthäuser vom Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Gab es eine Epoche, die Sie besonders faszinierte?
Hans Baer: Ich finde, alle Epochen haben etwas Reizvolles. Natürlich sind Lokale wie Gesellenstube, Badstube, Taverne besonders reizvoll, doch hier besteht das Problem in der eher dürftigen Quellenlage.
zu24: Sie schreiben, dass es in Embrach zeitweise mehr als zehn Wirtschaften gleichzeitig gab – bei weniger als 2000 Einwohnern. Wie erklären Sie diese hohe Dichte an Gastbetrieben?
Hans Baer: Es waren praktisch alles nur Nebenerwerbszweige.
zu24: Welche Berufe übten die Besitzer nebenbei aus?
Hans Baer: Sie waren Müller, Metzger, Coiffeur, Weinbauern, Bäcker, um die wichtigsten zu nennen.
zu24: Welche Rolle spielten die Wirtschaften im gesellschaftlichen Leben von Embrach? Waren sie nur Treffpunkte für Einheimische oder auch für Reisende von Bedeutung?
Hans Baer: Die Bedeutung für Reisende war sehr eingeschränkt, diese Berechtigung hatte die Taverne inne. Andere Lokale waren bloss zeitweise Trinklokale. Speisewirtschaften kamen erst Ende 19. Jh. auf, im Zusammenhang mit der Eröffnung der Bahnlinie der Nordostbahn 1876.
zu24: Gab es eine Wirtschaft mit einer besonders spannenden oder kuriosen Geschichte, die Ihnen bei der Recherche besonders in Erinnerung geblieben ist?
Hans Baer: Die Obermühle mit ihrer legendären Wirtin Lisette, die ihre Preise immer in Rappen nannte. – Das Neugut, dessen Wirt ein Embracher Lehrer war.
zu24: Sie haben für die Broschüre zahlreiche Illustrationen verwendet. Welche Quellen standen Ihnen dabei zur Verfügung, und gab es Überraschungen bei der Bildrecherche?
Hans Baer: Meine eigene sehr umfangreiche Privatsammlung, mein eigenes Fotoarchiv, Internet, Staatsarchiv Zürich.
zu24: Sie geben Ihre historischen Broschüren im Eigenverlag heraus und investieren viel Zeit und Geld in diese Projekte. Was treibt Sie an, diese Arbeit trotz finanzieller Einbussen fortzusetzen?
Hans Baer: Damit meine Arbeiten nicht auf meiner Festplatte verrotten, bediene ich regelmässig Staatsarchiv, Zentralbibliothek Zürich, Landesbibliothe Bern, Stadtbibliothek Winterthur und in gewissen Fällen die Bibliothek der kantonalen Denkmalpflege. Zu diesem Zweck müssen die Arbeiten in gedruckter Form erscheinen. – Schliesslich kostet ja jedes Hobby! Wenn dann noch einige Interessierte ein Exemplar kaufen, reduziert das meine Selbstkosten.
Früher übernahm die Kulturkommission Embrach (auch mein Kind!) die Druckkosten und legte den Preis fest. Als ich die Geschichte von Jakob Ganz publizieren wollte, meinte man, ich solle mich an die ref. Kirche wenden. Diese lehnte aber mein Gesuch ab, weil die beschriebene Person immer noch nicht ins kirchliche Konzept passte. So begann ich mit dem Selbstverlag und wurde dadurch total unabhängig.
zu24: Wie haben sich die Embracher Wirtschaften im Laufe der Jahrzehnte verändert, und gibt es noch Spuren dieser historischen Gasthäuser in der heutigen Gastronomielandschaft?
Hans Baer: Von den beschriebenen 20 Wirtschaften existieren deren 5 bis auf den heutigen Tag, und natürlich sind eine ganze Reihe weiterer dazugekommen, leider meistens in Form von Pizzerien.
zu24: Sie haben bereits über 40 historische Broschüren veröffentlicht. Welche Themen haben Sie als Nächstes im Blick, und gibt es weitere lokale Geschichten, die Sie erforschen möchten?
Hans Baer: Gegenwärtig habe ich noch keine spruchreifen Projekte, möchte aber vielleicht noch "Embrach in der Kartografie" fertigstellen. Hier muss ich allerdings mit dem Format A4 quer arbeiten, was eine Auflage deutlich verteuert. Dazu muss ich auch langsam mein Alter berücksichtigen.